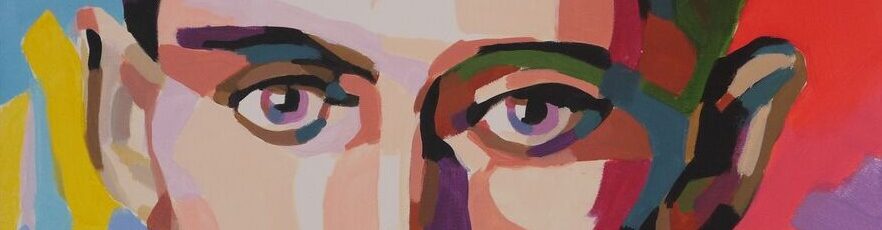Auch Kafkas künstlerisches Schaffen kann hier nicht umfänglich ausgeleuchtet werden, sondern soll beispielhaft vorgestellt werden. Wichtig ist mir dabei, Kafka als Künstler im umfassenden Wortsinn zu verstehen, der neben seinem weltberühmten erzählerischen Werk auch als Verfasser von Gedichten und inbesondere als Zeichner wahrgenommen wird.
Da uns weite Teile von Kafkas Werk ohne Max Brod verborgen geblieben wären, soll eingangs Brods Entscheidung, Kafkas letzten Willen zu missachten, beleuchtet werden. Ferner soll das einzigartige Entstehen seiner Texte, die Glückensbedingungen seines Schreiben, in den Blick geraten.
Kafkas letzter Wille
Kafka war zu Lebzeiten lediglich ein regionaler Autor und bloß einer kleinen literarisch gutgebildeten Leserschaft bekannt. Sein veröffentlichtes Werk umfasste nur wenige hundert Druckseiten – darunter Die Verwandlung als seine mit 70 Seiten längste Publikation. Thomas Mann oder Arthur Schnitzler als Zeitgenossen beispielsweise wurden erst nach seinem Tod auf ihn aufmerksam. Er war bei Weitem kein bekannter Autor, schon gar nicht ein Schriftsteller von Weltruhm.
Nach seinem Willen sollte es so bleiben. Alles Geschriebene „restlos und ungelesen zu verbrennen“1, wünschte sich Kafka testamentarisch von Max Brod. Und das sogar zweimal. Der Freund widersetzte sich diesem letzten Willen und veröffentlichte alles von Kafka Geschriebene – neben den bis dahin unveröffentlichten literarischen Schriften (darunter die drei großen Romanfragmente) auch alles Persönliche von den Liebesbriefen bis zu den Tagebüchern. All das, was er aus Schubläden, Bücherkästen, dem Schreibtisch oder dem Wäscheschrank emporhob, gehört heute zum bedeutendsten literarischen Erbe des 20. Jahrhunderts und Franz Kafka zum Kanon der Weltliteratur.
Schon am Tag nach Kafkas Tod beginnt Brod damit, Kafkas unveröffentlichte Schriften dem Publikum anzupreisen. Er kündigt im Prager Tageblatt vom 4. Juni 1924 Kafkas Prozess als dessen „größtes Werk“2 an, das überdies „vollendet“3 vorliege. Sechs Wochen später bekundet er öffentlich in seinem berühmten Beitrag in der Weltbühne den längst gefassten Entschluss, Kafkas Nachlass, beginnend mit dem Prozess, zu publizieren und sich den Testamenten zu widersetzen.
Im Beitrag der Weltbühne begründet Brod dann sein Vorgehen aus den „allertrifftigsten Gründen“4. Neben eingangs etwas konstruiert wirkenden Argumenten, Kafka habe seinen letzten Willen selber desavouiert – aus einsetzender Altersmilde seinem eigenen Werk gegenüber, seiner nimmermüden Arbeit am Hungerkünstlerband noch vom Sterbebett aus oder weil Kafka schon zu Lebzeiten mit ihm abgerungenen Veröffentlichungen in der Rückschau immer einverstanden gewesen sei – führt Brod als alles überstrahlendes Argument den literarischen Wert der nachgelassenen Schriften ins Feld: „Entscheidend ist dabei natürlich nichts von dem bisher Vorgebrachten, sondern einzig und allein die Tatsache, daß der Nachlaß Kafkas die wundervollsten Schätze, auch an seinem eignen Werk gemeßen das Beste, was er geschrieben hat, enthält.“5 Es ist Brods Lebensleistung, seinem literarischen Urteil und Instinkt gefolgt zu sein – auch oder gerade gegen den Willen des Freundes.
Kafkas Schreiben
Ein Blick auf die berühmte und viel zitierte Tagebucheintragung Kafkas vom 23. September 1912, die am Morgen nach der Niederschrift des Urteils entsteht, offenbart die Glückensbedingungen, die Kafka fortan an sein Schreiben knüpft:
„Diese Geschichte ‚das Urteil’ habe ich in der Nacht vom 22. zum 23. von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem Zug geschrieben. […] Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die Geschichte vor mir entwickelte wie ich in einem Gewässer vorwärtskam. Mehrmals in dieser Nacht trug ich mein Gewicht auf dem Rücken. Wie alles gewagt werden kann, wie für alle, für die fremdesten Einfälle ein großes Feuer bereitet ist, in dem sie vergehn und auferstehn. […] Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele.“6
Das, was Kafka sich fortan als Prämissen für gelingendes Schreiben selbst auferlegte, war eine große Bürde und ein Grund, warum die meisten seiner Texte Fragment blieben und seine Romane unvollendet: Da war zunächst das Schreiben ‚in einem Zug‘. Kafka sehnte sich danach, seine Geschichten durch die „Nächte zu jagen“7; sollte ein Text seinen Ansprüchen genügen, musste er in einem ununterbrochenen, kontinuierlichen Schreibvorgang entstehen.8 Solch ein Schreiben duldet keine Störungen von außen, duldet keine Müdigkeit. Brach das Schreiben ab, war ein Zurück fast ausgeschlossen und der Text verloren.
Dieses Faktum ist ursächlich mit der zweiten Glückensbedingung seines Schreibens verbunden: der unmittelbaren Verkopplung von Erfindung und Niederschrift seiner Texte. Kafka machte sich im Vorfeld der Entstehung eines neuen Textes keine Notizen, es gab keinen Schreibplan, keine Ideensammlung. Es reichte ihm ein starkes Bild, ein zentraler Einfall und der Text entfaltete sich wie bei Kleists ‚allmählicher Verfertigung der Gedanken beim Reden‘ im Schreibprozess selbst. In der Tagebucheintragung zum Urteil nutzt Kafka selbst das Bild des Schmelztigels, des großen Feuers, das Gedanken verschmelzen lässt und in neuer Form zutage fördert. Von Max Brod überliefert ist das Bild über Kafkas Schreibens wie in einen dunklen Tunnel hinein, „ohne daß man weiß, wie sich die Figuren entwickeln werden.“9 Ebenso kann man sich Kafkas „Aus-dem-Augenblick-heraus-Produzieren“10 so vorstellen, als steige man eine Treppe hinauf, wobei „die nächsten Treppenstufen sozusagen jeweils im Weitergehen selbst zuwachsen.“11 Alle Bilder veranschaulichen einen Schreibvorgang, der Inspiration mit Ekstase verbindet. Die Manuskriptbefunde belegen, dass umso tiefer Kafka in seine Texte einzutauchen vermochte (‚im Gewässer vorwärtskam‘), desto kleiner wurde die Schrift, desto mehr Worte zählen wir pro Seite, desto geringer die nötigen späteren Korrekturen.
Kafkas Prosa
Vielleicht ist es einen Gedanken wert, Kafkas Prosa, so fragmentarisch die meisten Texte auch sind, gewissermaßen als Teile eines Ganzen, eines großen Erzählangangs zu lesen. Ihre unübersehbare thematisch Ähnlichkeit stützt diese These: Es sind einerseits Vergeblichkeitsgeschichten, in denen die Protagonisten scheitern. Ihr Nicht-Ankommen ist ein Grundthema im erzählerischen Werk Kafkas, wie beispielsweise im Schlossroman, in dem der Landvermesser K. nicht ins Schloss gelangt oder in der Türhüterlegende Vor dem Gesetz, in der der Mann vom Lande keinen Eintritt in das Gesetz erhält. Auch Gibs auf! und Eine kaiserliche Botschaft erzählen die Unmöglichkeit des Ankommens, der kurze Text Heimkehr die Unmöglichkeit der Rückkehr.
Viele Texte sind zudem Texte der scheiternden Kommunikation, ein weiteres Grundmotiv von Kafkas Prosa. Der Bote in der Kaiserlichen Botschaft scheitert, die Nachricht zu übermitteln, die Kommunikation mit dem Schutzmann führt den Erzähler in Gibs auf! nicht zu seinem Ziel, den Bahnhof zu erreichen und in Heimkehr bleiben sich Sohn und Familie durch sein Zögern fremd, sodass erst gar keine Kommunikation möglich wird. Misslingende Kommunikation zeigt sich zum Beispiel auch in der Verwandlung, Gregor Samsa wird in seiner Familie nicht nur räumlich, sondern insbesondere kommunikativ isoliert oder im Prozessroman, in dem der Angeklagte Josef K. nie mit dem Gericht oder einem Richter über seinen Prozess ins Gespräch kommen wird.
Kafkas Texte erzählen zudem in kristallklarer, schnörkelloser, auf syntaktischer und lexikalischer Ebene unmittelbar und leicht zugänglicher Sprache von Inhalten, die unverständlich und rätselhaft scheinen. Diese ästhetische Spannung ist Kernelement von Kafkas erzählerischem Werk, den Lesenden mit auf das Wesentliche konzentrierter sprachlicher Prägnanz in literarische Wirklichkeiten zu führen, die sich unserem Verstehen entsagen. Häufig versprachlicht Kafka diese unwirklichen Wirklichkeiten bereits in seinen ersten Sätzen wie in der Verwandlung oder dem Prozess: Warum verwandelt sich Gregor Samsa in ein Ungeziefer oder warum wird Josef K. eines Morgens aus dem Bett heraus verhaftet?
All das kulminiert in der strukturellen Deutungsoffenheit von Kafkas Prosa, die den Reiz begründet, den im Verborgen geglaubten Sinn nachzuspüren. Eine Suche, die Fragen stellt, die sich an Kafkas Texte richten, sich am Ende aber auf uns selbst beziehen.
Kafkas Lyrik
Kafkas Lyrik ist bislang kaum betrachtet und wenig gewürdigt wurden. Kafka hat – je nach Auslegung des Gattungsbegriffes – bis zu 20 Gedichte verfasst. Sie entstammen überwiegend seinem dichterischen Frühwerk und sind kaum erforscht. Von Erkenntnisinteresse müsste sein, ob Kafka in ihnen die zentralen Themen seiner erzählenden Texte vorwegnimmt und wie er sie im sprachlich verdichteten Genre der Lyrik entfaltet. Kafkas Prosa wird für ihre sprachliche Nüchternheit und Klarheit gerühmt – wie vermag der junge Schriftsteller rhythmische Elemente und bildhafte Sprache in Strophen und Versen einzusetzen? Und gilt das Strukturprinzip der Deutungsoffenheit seiner Texte in gleicher Absolutheit auch für die lyrischen?
Ebenso wird zu bewerten sein, ob epochentypische Merkmale der Lyrik der Moderne oder des Expressionismus seinen lyrischen Texten eher zuzuordnen sind als seinen epischen.
Wie immer stellt sich gerade bei Gedichten die Frage nach der literarischen Wertung: berühren uns die Texte, lassen sie Bilder in uns entstehen, lösen sie etwas in uns aus?
Hier einige Kostproben: Die Gedichte In der abendlichen Sonne (1904), Kleine Seele (1909) und In dem alten Städtchen (1903), die allesamt keinen Titel tragen und hier nach ihrem ersten Vers benannt werden, finden sich wie alle seine Gedichte verstreut in Kafkas Briefen, Tagebüchern und nachgelassenen Schriften.
In der abendlichen Sonne
In der abendlichen Sonne
sitzen wir gebeugten Rückens
auf den Bänken in dem Grünen.
Unsere Arme hängen nieder,
unsere Augen blinzeln traurig.
Und die Menschen gehn in Kleidern
schwankend auf dem Kies spazieren
unter diesem großen Himmel,
der von Hügeln in der Ferne
sich zu fernen Hügeln breitet.12
Kleine Seele
Kleine Seele
springst im Tanze
legst in warme Luft den Kopf
hebst die Füße aus glänzendem Grase
das der Wind in zarte Bewegung treibt13
In dem alten Städtchen
In dem alten Städtchen stehn
Kleine helle Weihnachtshäuschen,
Ihre bunte Scheiben sehn
Auf das schneeverwehte Plätzchen.
Auf dem Mondlichtplatze geht
Still ein Mann im Schnee fürbaß,
Seinen großen Schatten weht
Der Wind die Häuschen hinauf.14
Kafkas Zeichungen
Seit der einem Kriminalfall gleichende Rechtsstreit um den Nachlass von Max Brod entschieden ist und im Jahr 2019 die Bankschließfächer mit bis dahin über 100 unbekannten Zeichnungen Kafkas in Zürich geöffnet wurden, muss Franz Kafka auch als bildender Künstler von Rang wahrgenommen werden. Brod vererbt seiner Sekretärin llse Ester Hoffe die in seinem Nachlass erhaltenen Originale von Kafkas Zeichnungen. Als Hoffe 2007 im Alter von 101 Jahren stirb, reklamiert die Nationalbibliothek in Jerusalem den gesamten Nachlass Max Brods als öffentliches Eigentum. Nach fast 10-jährigem Prozess gibt das Oberste Gericht Israels dieser Auffassung Recht: Kafkas letzter literarische und künstlerische Schatz aus den Züricher Safes der Familie Hoffe kann geborgen werden.
Von entscheidendem Erkenntniswert war dabei, sein zeichnerisches Werk nicht länger als Illustrationen seiner literarischen Produktion misszuverstehen (wie die wenigen von Brod vorab veröffentlichten Zeichnungen uns glauben machen konnten, die ab den 1950er Jahren die Umschläge von Kafkas Taschenbuchausgaben zierten), sondern als eigenständige Zeichnungen, als autonome Kunstwerke.
Die überwiegende Anzahl dieser Zeichnungen stammen – wie wir nun wissen – aus einem Zeichnungsheft, das Kafka zwischen 1901 und 1907 zur Zeit seines Jurastudiums in Prag, also lang vor Entstehen seiner großen Texte, nutzte. Offensichtlich hatte Kafka tatsächlich jene künstlerische „Doppelbegabung“15, die Brod in ihm erkannte. Er wollte ihn früh als bildenden Künstler etablieren und preiste Kafka in Künstlerkreisen als großen Künstler, dessen Zeichnungen an die von „Paul Klee oder an Kubin erinnerten.“16
Schon zu Lebzeiten anerkannte und würdigte Kafka selbst den Wert seiner Zeichnungen. An Felice Bauer schreibt er am 11./12. Februar 1913: „Ich war einmal ein großer Zeichner“17 Und weiter: „Jene Zeichnungen haben mich zu seiner Zeit, es ist schon Jahre her, mehr befriedigt als irgendwas.“18
- Max Brod/Franz Kafka, 1989, Eine Freundschaft. Briefwechsel. hrsg. von Malcom Pasley, Frankfurt a.M.: S. Fischer, S. 365. ↩︎
- Max Brod, 1924, Franz Kafka gestorben, in: Prager Tageblatt (4. Juni 1924), in: Jürgen Born (Hg.), 1983, Franz Kafka. Kritik und Rezeption 1924-1938, Frankfurt a.M.: S. Fischer, S. 18. ↩︎
- Ebd. ↩︎
- Max Brod, 1924, Franz Kafkas Nachlaß, in: Die Weltbühne (17. Juli 1924), in: Jürgen Born (Hg.), 1983, Franz Kafka. Kritik und Rezeption 1924-1938, Frankfurt a.M.: S. Fischer, S. 39. ↩︎
- Ebd. S. 41. ↩︎
- Franz Kafka, 1990, Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Tagebücher, hrsg. v. Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcom Pasley, Frankfurt am Main: S. Fischer, S. 460f. ↩︎
- Ebd. S. 715. ↩︎
- Vgl. Jost Schillemeit, 2004, Das unterbrochene Schreiben. Zur Entstehung von Kafkas Roman ‚Der Verschollene’, in: Jost Schillemeit, Kafka-Studien, hrsg. v. Rosemarie Schillemeit, Göttingen: Wallstein Verlag, S. 211-224. Und: Malcom Pasley, 1980, Der Schreibakt und das Geschriebene. Zur Frage der Entstehung von Kafkas Texten, in: Franz Kafka. Themen und Probleme, hrsg. v. Claude David, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 9-25. ↩︎
- Max Brod, 1957, Uyttersprot korrigiert Kafka, in: Forum 43/44, S. 265. ↩︎
- Jost Schillemeit, 2004, Das unterbrochene Schreiben. Zur Entstehung von Kafkas Roman ‚Der Verschollene’, in: Jost Schillemeit, Kafka-Studien, hrsg. v. Rosemarie Schillemeit, Göttingen: Wallstein Verlag, S. 212. ↩︎
- Schillemeit spielt mit dieser Formulierung an auf eine berühmte Passage aus dem Fürsprecher-Fragment. Dort heißt es: „Solange du nicht zu steigen aufhörst, hören die Stufen nicht auf, unter deinen steigenden Füßen wachsen sie aufwärts.“ (Franz Kafka, 1993, Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Nachgelassene Schriften und Fragmente I, hrsg. v. Malcom Pasley, Frankfurt am Main: S. Fischer, S. 380.) ↩︎
- Kafka, F.: Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Briefe 1900-1912. Hg. v. Hans-Gerd Koch. Frankfurt am Main: S. Fischer. 1999. S. 57. ↩︎
- Kafka, F.: Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Tagebücher. Kommentarband. Hg. v. Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcom Pasley. Frankfurt am Main: S. Fischer 1990. S. 71. ↩︎
- Kafka, F.: Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Briefe 1900-1912. Hg. v. Hans-Gerd Koch. Frankfurt am Main: S. Fischer. 1999. S. 30. ↩︎
- Brod, M.: Franz Kafka. Glauben und Lehre. In: Max Brod (Hg.): Über Franz Kafka. Frankfurt: Fischer 1966. S. 393. ↩︎
- Kilcher, A.: Franz Kafka. Die Zeichnungen. S. 243. ↩︎
- Kafka, F.: Briefe 1913-1914. Hg. v. Hans-Gerd Koch. Frankfurt: S. Fischer 1999. S. 87. ↩︎
- Ebd. ↩︎